01. August 2025
Was tun, wenn das Unternehmen strauchelt?
Insolvenzrecht allgemein
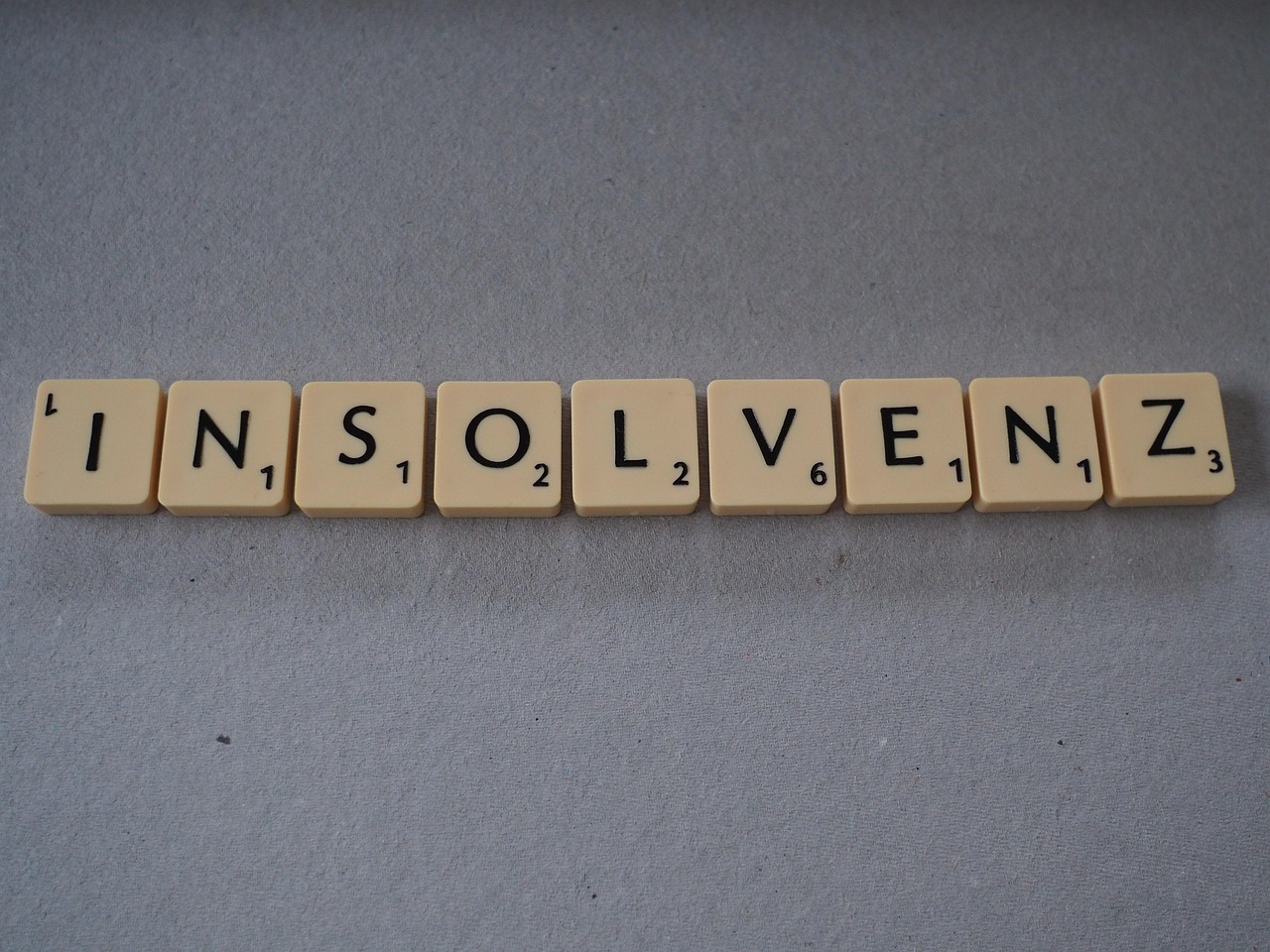 Quelle: pixabay.com
Quelle: pixabay.com Quelle: pixabay.com
Quelle: pixabay.comWenn ich als Inhaber oder Geschäftsführer eines Unternehmens Insolvenz anmelden muss – Was passiert dann alles?
Inhaltsverzeichnis
1. Was bedeutet eigentlich Insolvenz?
Ein Leitfaden für Unternehmer und Privatpersonen
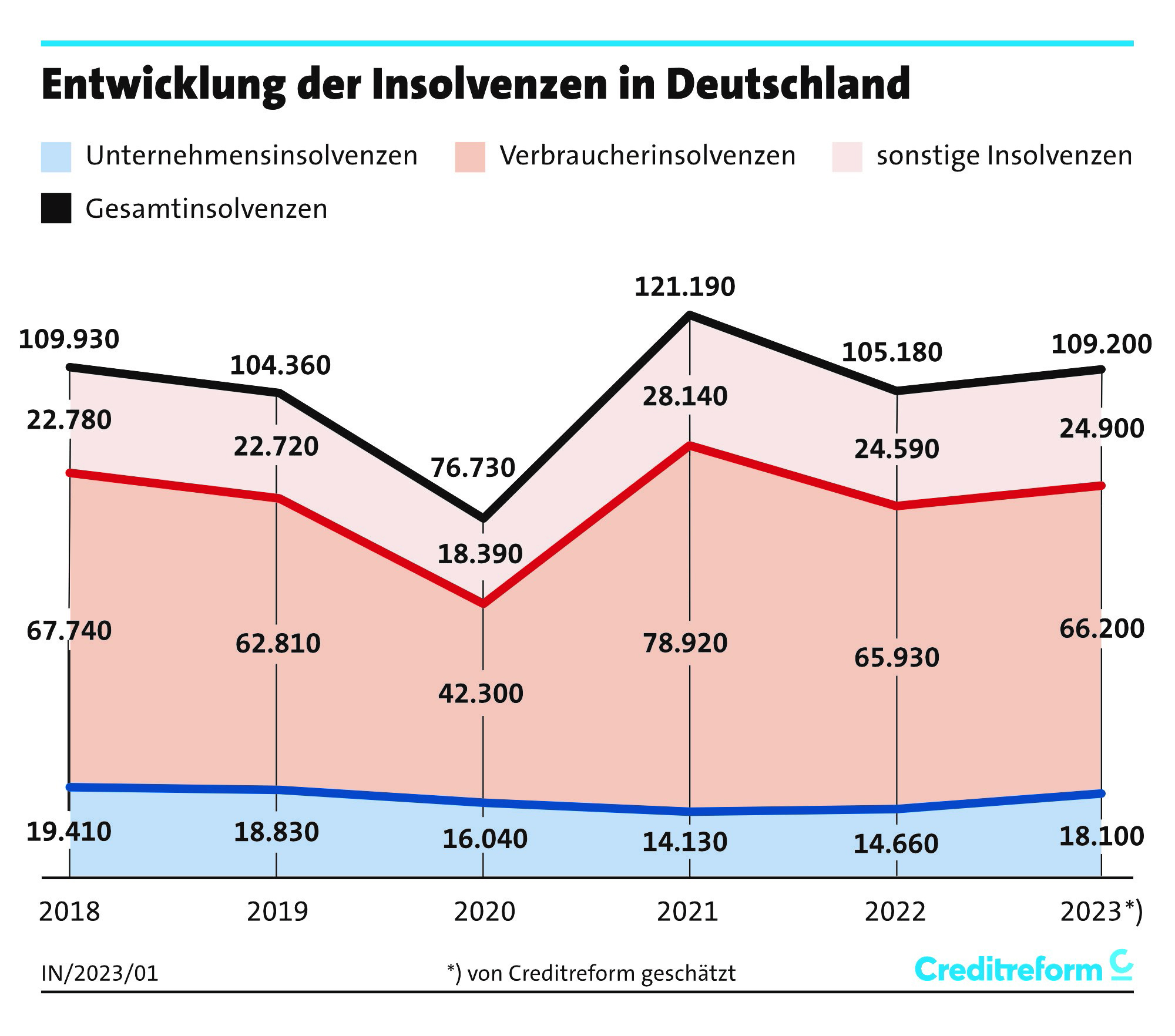 Quelle: Creditreform; https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news-details/show/insolvenzen-in-deutschland-jahr-2023
Quelle: Creditreform; https://www.creditreform.de/aktuelles-wissen/pressemeldungen-fachbeitraege/news-details/show/insolvenzen-in-deutschland-jahr-20231.1 Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung
Die Insolvenzgründe
1.2 Die Ziele des Insolvenzverfahrens
2. Die wichtigsten Begriffe im Insolvenzrecht einfach erklärt
Was passiert, wenn ich als Inhaber eines Unternehmens Insolvenz anmelden muss?
3.1 Die Pflicht zur rechtzeitigen Antragstellung
3.2 Der Weg zum Insolvenzantrag
3.3 Das vorläufige Insolvenzverfahren
3.4 Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
3.5 Die Rolle des Unternehmers während des Verfahrens
4. Verbraucher-/Privatinsolvenz in Deutschland
Voraussetzungen und Ablauf
Fazit:
Insolvenz ist die Chance auf einen finanziellen Neustart
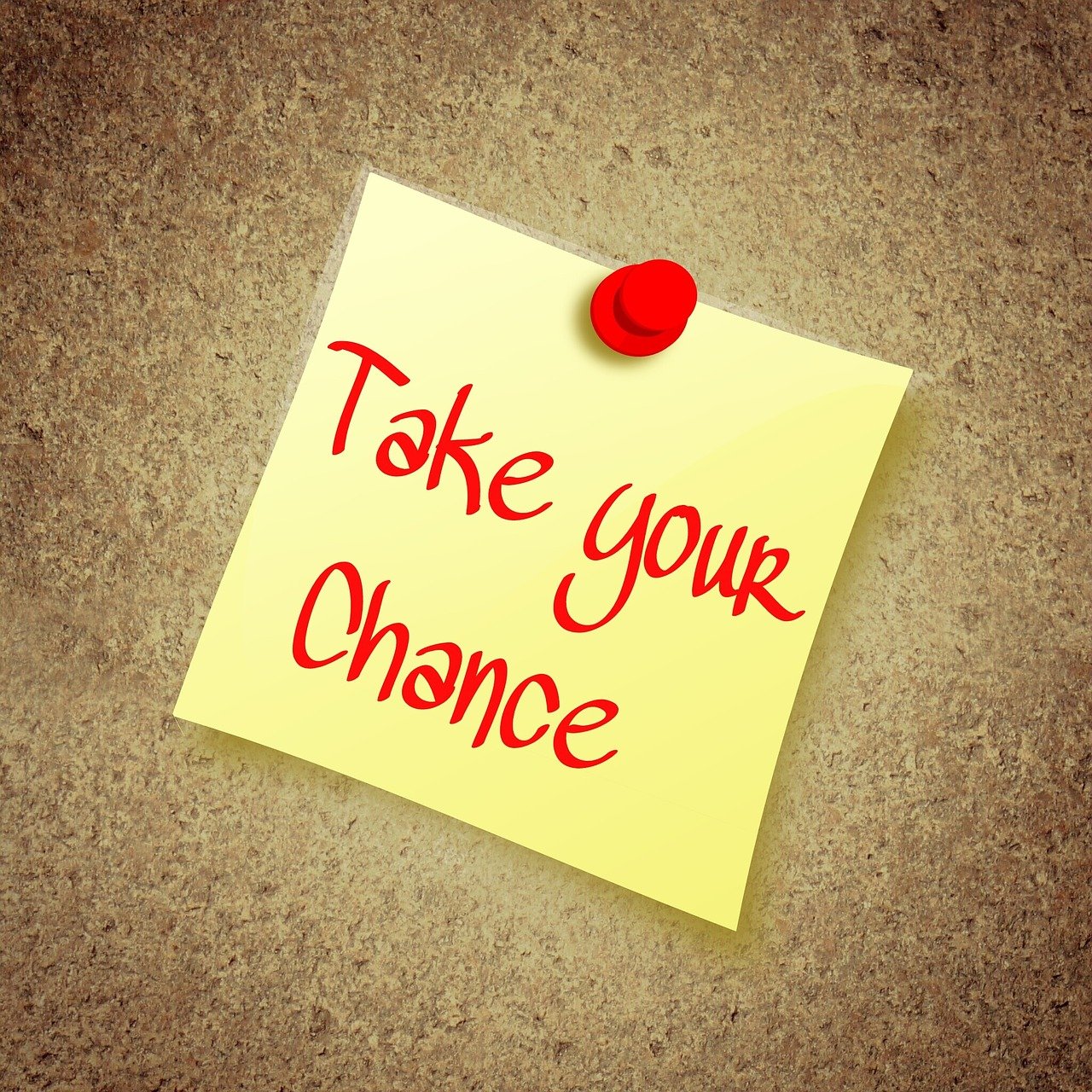 Quelle: pixabay.com
Quelle: pixabay.com